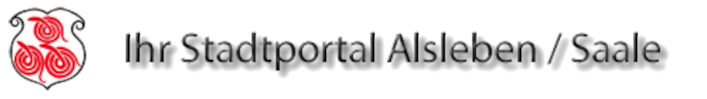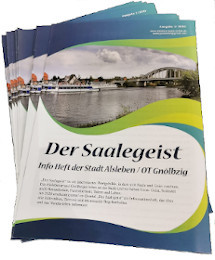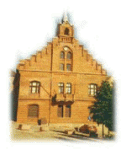
Herzlich willkommen in der Schiffer- und Mühlenstadt Alsleben (Saale)!
Hier finden Sie nützliche Informationen, die Ihnen helfen, alte Erinnerungen aufzufrischen oder Alsleben neu kennenzulernen.
Alsleben gehört zum Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt und liegt etwa in der Mitte zwischen Halle und Magdeburg, am östlichen Ausläufer des Harzvorlandes im malerischen Saaletal.
Dank der modernen Medienwelt können wir über das Internet näher mit unseren Bürgerinnen und Bürgern in Kontakttreten. Für viele, die nicht mehr in Alsleben wohnen, bleibt so ein Stück Heimat lebendig.
In der heutigen Zeit stehen Städte im Wettbewerb miteinander, und niemand möchte zu den Verlierern gehören. Wer keine neuen Informationsquellen anbietet und den Kontakt zu seinen Bürgern nicht pflegt, wird schnell ins Hintertreffengeraten. Die Stadt Alsleben (Saale) nutzt die Möglichkeiten multimedialer Angebote und stellt diese auf unserer Webseite zur Verfügung.
Informieren Sie sich kurz und prägnant über Alsleben (Saale) – so werden Sie feststellen, dass sich ein Besuch in unserer Schiffer- und Mühlenstadt lohnt.
Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich um eine privater stellte Internetseite meiner Heimatstadt handelt. Anfragen zu Vereinen und zur Stadt werden gerne weitergeleitet.
Ich wünsche allen Besuchern einen schönen Tag und heiße Sie herzlich willkommen in Alsleben (Saale)!
Wichtige Links